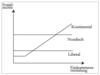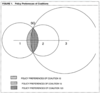1 Grundlagen Flashcards
(142 cards)
1. Was ist Politikwissenschaft?
a) Einführung: Was ist Politik?
b) Was Politikwissenschaft ist!
c) Wozu braucht die Politikwissenschaft Theorien?
d) Politik verstehen: Einführung in die wichtigsten Erklärungsansätze 1
e) Politik verstehen: Einführung in die wichtigsten Erklärungsansätze 2
f) Politik verstehen: Einführung in die wichtigsten Erklärungsansätze 3
g) Bsp.: staatliche Umverteilung: Erklärung aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven
- Politik und Politikwissenschaft
- Wozu braucht die Politikwissenschaft Theorie?
- Politik verstehen: Einführung in die wichtigsten Erklärungsansätze:
- Strukturalismus
- Institutionalismus
- Rational Choice
- Kulturalismus
Akteur
- Ein Individuum oder ein Kollektiv, der/das den Entscheidungsprozess in einem politischen System beeinflusst
- z.B. Parlament, Fraktionen, Politiker, Interessensgruppen, Verbände etc.
Institutionen
- Dauerhafte, formelle oder informelle Spielregeln einer Gesellschaft, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben strukturieren
- z.B. Zauberformel (informell), Regeln der Mehrheit (formell)
Politik
- umfasst die Strukturen und Prozesse zur Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Entscheidungen und Regeln (Inhalte)
- z.B. Wahlen und Abstimmungen, Parteipolitik, Demokratisierungsprozesse, das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament, Umweltpolitik, internationale Kooperation, Kriege
- Policy: Inhalte
- Politics: Prozesse
- Polity: Strukturen
Politikwissenschaft
- untersucht Politik auf wissenschaftliche Art und Weise
Politikwissenschaft: ein sozialwissenschaftliches Querschnittsfach
- Ökonomie
- Geschichte
- Philosophie
- Soziologie
- Psychologie
- Jus
Teilbereiche der Politikwissenschaft
- Politische Theorie
- Innenpolitik (z.B. Schweizer Politik)
- Vergleichende Politikwissenschaft
- Internationale Beziehungen
- Methoden der Politikwissenschaft
Zusammenspiel Akteure & Institutionen
- Wie beeinflussen die Institutionen das Verhalten der Akteure?
- Wie wird das Zusammenwirken der Akteure von Instutionen beeinflusst
Historische Einordnung
- Politikwissenschaft als sehr alte und sehr junge Wissenschaft
- Entwicklungsrhythmus: Zeitkritischer Charakter der Politikwissenschaft (“Krisenwissenschaft”)

Frühe Hochkulturen / Antike
- gesellschaftlicher Regulierungsbedarf bereits vor Erfindung der Schrift
- systematisierte Beschäftigung mit Politik im 4./3. Jahrhundert v.Ch. im antiken Griechenland
- Begründung durch Platon und Aristoteles: Reformen gegen Niedergang athenischen Stadtstaates
-
a. Platon (427-347):
- zeitkritische Auseinandersetzung mit der Polis
- glückliches Leben ist nur im gerechten Staat möglich
- Politik: Frage nach Wesen der Gerechtigkeit und der besten Verfassung menschlicher Gemeinschaft
-
b. Aristoteles(384-322)
- Politikwissenschaft als Teil der praktischen Philosophie («Königswissenschaft»)
- Mensch als von Natur aus politisches Wesen (zoon politikon); das seine Erfüllung nur in staatl. Gemeinschaft findet
- Politik: Schaffung guter Staatsordnung, um Individuum tugendhaftes, zufriedenes und gutes Leben zu ermöglichen
Platon (427-347):
- zeitkritische Auseinandersetzung mit der Polis
- glückliches Leben ist nur im gerechten Staat möglich
- Politik: Frage nach Wesen der Gerechtigkeit und der besten Verfassung menschlicher Gemeinschaft
Aristoteles (384-322)
- Politikwissenschaft als Teil der praktischen Philosophie («Königswissenschaft»)
- Mensch als von Natur aus politisches Wesen (zoon politikon); das seine Erfüllung nur in staatl. Gemeinschaft findet
- Politik: Schaffung guter Staatsordnung, um Individuum tugendhaftes und gutes Leben zu ermöglichen
Spätantike/Mittelalter
-
Augustinus (354-430)
- aufgrund des aufkommenden Christentums grundlegende Neuorientierung des Denkens über Politik
- zwei «Bürgerschaften»: irdisches, vergängliches Dasein (civitates terrena) vs. ewiges Heil im Jenseits (civitates dei)
- Politik: Vorbereitung auf das ewige Leben im Jenseits
-
Thomas von Aquin (1224-1275)
- Bruch mit dem augustinischen Dualismus der zwei Bürgerschaften
- Begründer Scholastik: Befreiung menschl. Vernunft/Wissenschaft von christl.-theolog. Bevormundung
- Politik: Verfolgung des individuellen irdischen Glücks und des Gemeinwohls im Rahmen des Staates
- (Scholastik = Denkweise & Methode der Beweisführung)
Augustinus (354-430)
- aufgrund des aufkommenden Christentums grundlegende Neuorientierung des Denkens über Politik
- zwei «Bürgerschaften»: irdisches Dasein (civitates terrena) vs. ewiges Heil im Jenseits (civitates dei)
- Politik: Vorbereitung auf das ewige Leben im Jenseits
Thomas von Aquin (1224-1275)
- Bruch mit dem augustinischen Dualismus der zwei Bürgerschaften
- Begründer Scholastik: Befreiung menschl. Vernunft/Wissenschaft von christl.-theolog. Bevormundung
- Politik: Verfolgung des individuellen irdischen Glücks und des Gemeinwohls im Rahmen des Staates
Neuzeit 1
- Abkehr der Politikwissenschaft von Aristoteles und der christlichen Tradition
- zunehmender Einfluss Naturwissenschaften & ihren Methoden auf Politik/Gesellschaft: Säkularisierung
- Säkualisierung = Loslösung des Einzelnen, des Staates & gesellschaftliche Gruppen aus den Bindungen an die Kirche
-
e. Niccolo Machiavelli (1469-1527)
- Mechanismen und Techniken des Regierens und des Machterhalts
- Abkehr vom sinnhaften Zielcharakter der Politik: Fakten anstatt Normen – Politik: Erhaltung der Republik um jeden Preis
-
f. Thomas Hobbes (1588-1679)
- Naturwissenschaftlicher Empirismus; skeptisches Menschenbild: egoistisches Triebwesen, Primat der Selbsterhaltung
- ohne staatliche Ordnung herrscht Gewalt/Krieg –> Legitimation staatlicher Macht (Monarchie/Absolutismus)
- Staat als Mechanismus der Befriedigung und Konfliktregulierung; Freiwillige Unterordnung von Individuen zu Selbstschutz
Niccolo Machiavelli (1469-1527)
- Mechanismen und Techniken des Regierens und des Machterhalts
- Abkehr vom sinnhaften Zielcharakter der Politik: Fakten anstatt Normen – Politik: Erhaltung der Republik um jeden Preis
Thomas Hobbes (1588-1679)
- Naturwissenschaftlicher Empirismus; skeptisches Menschenbild: egoistisches Triebwesen, Primat der Selbsterhaltung
- ohne staatliche Ordnung herrscht Gewalt/Krieg –> Legitimation staatlicher Macht (Monarchie/Absolutismus)
- Staat als Mechanismus der Befriedigung und Konfliktregulierung; Freiwillige Unterordnung von Individuen zu Selbstschutz
Neuzeit 2
-
g. John Locke (1632-1704)
- Abkehr vom pessimistischen Menschenbild und der Legitimation absoluter staatlicher Macht
- Mensch verfügt über unveräusserliche, vorstaatliche Rechte (etwa Eigentumsrecht)
- zentrale Verfassungsprinzipien wie Toleranzgedanke, Mehrheitsprinzip, Repräsentation, Gewaltentrennung, Volkssouveränität
- Staat dient der Gewährleistung der Sicherheit von Leben und Eigentum der Bürger und verzichtet auf Eingriffe in das Privatleben (politischer Liberalismus)
-
h. Jean Jacques Rousseau (1712-1788)
- Mensch im Naturzustand als unfreier Wilder, staatliche Gemeinschaft ermöglicht Entwicklung zum vernünftigen citoyen (normatives Staatsverständnis)
- Träger der Staatsgewalt: Allgemeinwille (volonté générale), der auf das Gute abzielt
- Staatliche Gemeinschaft ermöglicht moralische Entfaltung des Menschen, Primat des Allgemeinwillens
John Locke (1632-1704)
- Abkehr vom pessimistischen Menschenbild und der Legitimation absoluter staatlicher Macht
- Mensch verfügt über unveräusserliche, vorstaatliche Rechte (etwa Eigentumsrecht)
- zentrale Verfassungsprinzipien wie Toleranzgedanke, Mehrheitsprinzip, Repräsentation, Gewaltentrennung, Volkssouveränität
- Staat dient der Gewährleistung der Sicherheit von Leben und Eigentum der Bürger und verzichtet auf Eingriffe in das Privatleben (politischer Liberalismus)
Jean Jacques Rousseau (1712-1788)
- Mensch im Naturzustand als unfreier Wilder, staatliche Gemeinschaft ermöglicht Entwicklung zum vernünftigen citoyen (normatives Staatsverständnis)
- Träger der Staatsgewalt: Allgemeinwille (volonté générale), der auf das Gute abzielt
- Staatliche Gemeinschaft ermöglicht moralische Entfaltung des Menschen, Primat des Allgemeinwillens
Entwicklung zur modernen Sozialwissenschaft
- Industrielle Revolution führt zu sozioökonomischen und politischen Strukturveränderungen; Bedarf an empirisch- deskriptiven Daten (gemessen in der Realität) wächst
- normatives Element bleibt der Politikwissenschaft erhalten (Marx); auch aufgrund Entgegensetzung von Geistes- und Naturwissenschaften
- Entwicklung des modernen Nationalstaates im 19. Jahrhundert: Anstoss zur empirischen Tatsachenforschung aus der praktischen Politik selbst
- „Politische Wissenschaften“ als Stabilisierungsinstrument des obrigkeitsstaatlichen politischen Systems
Verselbständigung der empirischen Sozialwissenschaften
- ab 19. Jahrhundert: Verselbstständigung der an der Empirie orientierten Sozialwissenschaft; Politikwissenschaft verschwindet als Einzelwissenschaft
-
i. Max Weber (1864-1920)
- Beschäftigung mit politischen Phänomenen aus empirischer Sicht (moderner Staat, Bürokratie)
-
j. Karl Raimund Popper (1902-1994)
- Begründer des Kritischen Rationalismus: Gibt keine endgültige Gewissheit, auch in Wissenschaft nicht
Max Weber (1864-1920)
- Beschäftigung mit politischen Phänomenen aus empirischer Sicht (moderner Staat, Bürokratie)